Kollegiat*innen
UMG Clinician Scientist Kolleg
1. Förderperiode (2024 - 2026)
In der ersten Ausschreibungsrunde konnten insgesamt 6 Clinician Scientists in das Förderprogramm aufgenommen werden.

Dr. med. Beschan Ahmad - Biomarker in Charcot-Marie-Tooth
Beschan Ahmad beendete 2018 sein Studium an der Universität Rostock und ist seit 2019 als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Assistenzarzt in der Klinik für Neurologie in Göttingen tätig. Er befindet sich in der Weiterbildung zum Facharzt für Neurologie.
Sein wissenschaftliches Interesse gilt den genetischen und molekularen Grundlagen der Charcot-Marie-Tooth-Erkrankung (CMT), welche die häufigste heriditäre Neuropathie darstellt. Bei dieser Erkrankung bestehen sehr variable Einschränkungen der Erkrankten. Biomarker, Progressionsmarker oder therapeutische Ansätze gibt es bis heute nicht.
Im Rahmen des Projekts sollen in Kooperation mit dem Max-Plank-Institut für multidisziplinäre Naturwissenschaften Bio- und Progressionsmarker bei Patienten charakterisiert werden. Darüber hinaus werden die Bio- und Progressionsmarker in in-vitro-Experimenten auf therapeutische Relevanz untersucht.
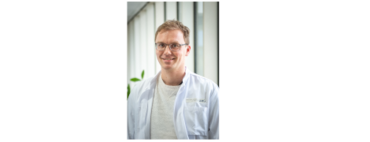
Dr. med. Jonas Franz - Identifikation molekularer Faktoren für erfolgreiche Remyelinisierung
Jonas Franz beendete sein Medizinstudium an der Universität Münster im Jahr 2015 und fokussierte sich dann zunächst auf ein parallel begonnenes Physikstudium, das er 2018 mit einem Master of Science beendete. Seine medizinische Promotion zum Thema entzündliche Aktivierung von Endothelzellen am Institut für Physiologie II der Universitätsklinik Münster schloss er 2017 ab und wurde dafür mit dem Dissertationspreis der Fakultät ausgezeichnet.
Seit 2018 ist er als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Assistenzarzt in der Neuropathologie der Universitätsmedizin Göttingen tätig. Er befindet sich in der Weiterbildung zum Facharzt für Pathologie.
Wissenschaftlich liegt der Fokus von Jonas Franz einerseits auf der Analyse von menschlichem Gewebe des zentralen Nervensystems und andererseits auf der methodischen Weiterentwicklung von digitale Neuropathologie in Verbindung mit räumlicher Transkriptionsanalyse. Er untersuchte u.a. die Ausbreitungsfähigkeit von SARS-CoV-2-Viren. Sein aktueller Forschungsschwerpunkt liegt auf humanen entzündlichen Prozessen und deren Verknüpfung zur Neurodegeneration. Zudem entwickelte er ein automatisiertes Verfahren zur automatisierten Analyse von Zellen des angeborenen Immunsystems. Für die Anwendung und Weiterentwicklung arbeitet er auf dem Norddeutschen Hochleistungsrechenzentrum (NHR-NORD, Link zum Projekt).
In seinem aktuellen Forschungsprojekt werden Reparationsmechanismen des Gehirns untersucht werden. Normalerweise kann das Gehirn Schäden an der „elektrischen Isolation“ der Nervenscheiden durch Remyelinisierung kompensieren. Bei der multiplen Sklerose scheint diese Kapazität erschöpft bzw. nicht funktional. Dieses Projekt zielt auf eine Bestimmung von molekularen Faktoren zur Wiederherstellung einer erfolgreichen Regeneration der Myelinscheiden des Gehirns von Patientinnen und Patienten mit multipler Sklerose.

Dr. med. Svante Gersch - Der Einfluss einer verbesserten Proteinhomöostase mittels HSPA4-Überexpression in einem HFpEF-Mausmodell
Svante Gersch beendete 2019 sein Studium an der Universität Göttingen und ist seit 2020 als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Assistenzarzt in der Klinik für Kardiologie & Pneumologie in Göttingen tätig. Er befindet sich in der Weiterbildung zum Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie.
Sein wissenschaftliches Interesse gilt der Herzinsuffizienz mit erhaltener Pumpfunktion (HFpEF), die in den kommenden Jahren zur häufigsten Herzinsuffizienz-Form aufsteigen wird und für die bisher keine prognoserelevante Therapie identifiziert werden konnte. In den letzten Jahren mehrten sich die Hinweise darauf, dass die zelluläre Proteinakkumulation und -aggregation mit nachgeschalteter Beeinträchtigung der Proteinqualitätskontrolle eine wichtige Rolle im pathophysiologischen Prozess der HFpEF spielt. Das Hitzeschockprotein A4 (HSPA4) gehört zur HSP110-Familie und fungiert als Co-Chaperon für HSP70. HSPA4 spielt eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung der zellulären Proteinhomöostase ein.
Im Rahmen des Projekts soll in einem murinen HFpEF-Modell der Einfluss einer verbesserten Proteinhomöostase mittels HSPA4-Überexpression auf das kardiale Remodeling und der Entwicklung der diastolischen Dysfunktion untersucht werden. Weiterführende Experimente sollen zudem den Einfluss der HSPA4-Überexpression auf die HFpEF-begleitende Fibrose und ventrikuläre Steifigkeit untersuchen.

Dr. med. Katharina K. Hahn - Untersuchung patientenindividueller Effekte spezifischer Systemtherapeutika auf die neurokutane Inflammation bei atopischer Dermatitis
Katharina Hahn beendete 2021 ihr Studium an der Medizinischen Hochschule in Hannover und ist seit 2023 als Assistenzärztin in der Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie der Universitätsmedizin Göttingen tätig.
Ihr wissenschaftliches Interesse gilt der Erforschung der neurokutanen Inflammation bei chronisch entzündlichen Hauterkrankungen. Die häufigste chronisch entzündliche Hauterkrankung ist die atopische Dermatitis, bei welcher ekzematöse Läsionen und ausgeprägter Juckreiz eine hohe Krankheitsbelastung für betroffene Patienten darstellen. Die atopische Dermatitis ist eine Erkrankung multifaktorieller Genese, welche insbesondere durch die Dominanz proinflammatorischer Th2-Zellen und ihrer Interaktion mit sensorischen Neuronen vermittelt wird. Während neue Systemtherapeutika über die Blockierung der Signaltransduktion von Th2-Zytokinen vielversprechende Therapieoptionen bieten, fehlen bislang geeignete in vitro Modelle, um ihren Einfluss auf sensorische Neuronen, Th2-Zellen und Keratinozyten zu untersuchen.
Im Rahmen des Projekts soll ein Th2-immunkompetentes und sensorisch innerviertes Vollhautmodell der atopischen Dermatitis etabliert und charakterisiert werden. Durch die Verwendung primärer Immunzellen von Patienten im Vollhautmodell soll ein Verfahren entwickelt werden, das eine individuelle Prognose des Therapieansprechens auf verschiedene Systemtherapeutika der atopischen Dermatitis ermöglicht.

Jacob Hamm - Funktionelle Charakterisierung des Mikrobioms und mikrobieller Metabolite für die Entstehung, Progression und das Therapieansprechen beim Pankreaskarzinom
Jacob Hamm beendete im Juni 2022 sein Studium an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und ist seit September 2022 als Assistenzarzt in der Klinik für Gastroenterologie, gastrointestinale Onkologie und Endokrinologie der Universitätsmedizin Göttingen tätig.
Bereits innerhalb seiner Dissertation widmete er sich nach Erhalt eines Stipendiums der Research Training Group (RTG) 1743 „Genes, Environment, Inflammation“ der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) der Untersuchung von Interaktionen zwischen dem intestinalen Mikrobiom und Metabolismus bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen.
Ziel des Projekts, welches durch das Clinician Scientist Kolleg „Zelldynamik in Pathogenese und Therapie“ gefördert wird, ist die Identifizierung von Signaturen des intestinalen Mikrobioms sowie deren Metabolite die mit der Entstehung, Progression und dem Therapieansprechen bei Patient*innen mit Pankreaskarzinom assoziiert sind. Nachfolgend sollen diese Erkenntnisse in translationale Modelle überführt werden um eine funktionelle Charakterisierung dysregulierter mikrobieller Spezies und ihrer Metabolite in der Pathogenese des Pankreaskarzinoms vorzunehmen. Das Projekt wird unter der wissenschaftlichen Betreuung von Prof. Dr. Ellenrieder (Leiter der Klinik für Gastroenterologie), Prof. Dr. Dr. Neeße (Oberarzt der Klinik für Gastroenterologie) und Dr. Ammer-Herrmenau (Assistenzarzt der Klinik für Gastroenterologie) sowie in Kollaboration mit Prof. Dr. Brockmöller (Institut für Klinische Pharmakologie) durchgeführt.
Dr. med. Sandrina Weber - α-Synuclein-Aggregation und extrazelluläre neuronale Vesikel im peripheren Blut als diagnostische und prognostische Biomarker in Patientenkohorten mit einem prodromalen oder manifesten M. Parkinson
Sandrina Weber beendete ihr Studium 2018 an der Technischen Universität München und begann ihre klinische Tätigkeit an der auf Bewegungsstörungen spezialisierten Paracelsus Elena-Klinik Kassel. Seit 2021 ist sie als Assistenzärztin in der Klinik für Neurologie in Göttingen tätig. Sie befindet sich in der Weiterbildung zur Fachärztin für Neurologie.
Ihr wissenschaftliches Interesse gilt der Identifizierung von Biomarkern bei M. Parkinson und atypischen Parkinson-Syndromen. Aktuell kann M. Parkinson nur postmortal durch den neuropathologischen Nachweis von aggregiertem α-Synuclein (aSyn) sicher diagnostiziert werden. Für diese an Prävalenz zunehmende Erkrankung existieren zudem trotz intensiver Forschung keine Medikamente, die den Verlauf modifizieren oder die Neurodegeneration aufhalten können. Einer der Hauptgründe für das Scheitern klinischer Medikamentenstudien ist das Fehlen objektiver Biomarker, die zum einen eine sichere und vor allem frühzeitige Diagnose gewährleisten und zum anderen eine Prognose über den Krankheitsverlauf ermöglichen.
Ziel des Projekts ist die Etablierung eines aSyn-Aggregationsassays als diagnostischer Biomarker im peripheren Blut und die nachfolgende Evaluation in einer populationsbasierten Parkinson-Risikokohorte. Als weitere blutbasierte Biomarker für die Progression und Differentialdiagnose der Erkrankung werden aSyn-tragende extrazelluläre Vesikel (EV) des Nervensystems untersucht. Hierfür wird unter anderem das aSyn-Aggregationsverhalten der EVs in Zellmodellen analysiert, um die molekularen Mechanismen der aSyn-Aggregation besser zu verstehen.
Das Projekt erfolgt in Kooperation mit Prof. Dr. Brit Mollenhauer (AG für Translationale Biomarkerforschung bei Neurodegenerativen Erkrankungen an der UMG und Chefärztin der Paracelsus Elena-Klinik, Kassel) und Prof. Dr. Tiago Outeiro (Leiter der Abteilung für Experimentelle Neurodegeneration, UMG).
2. Förderperiode (2025 - 2027)
In der zweiten Ausschreibungsrunde wurden insgesamt 3 Clinician Scientists in das Förderprogramm aufgenommen.
Dr. med. Jeanne-Marie Franke - H3K27M/BRAFV600E doppelmutierte Diffuse Mittelliniengliome. Analyse von Resistenzmechanismen unter BRAF/MEK-Inhibitor Behandlung in primären und isogenen Tumormodellen sowie Patientenproben.
Jeanne-Marie Franke beendete 2023 ihr Studium an der Medizinischen Hochschule Hannover und ist seither als Assistenzärztin in der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin der Universitätsmedizin Göttingen tätig. Sie befindet sich in der Weiterbildung zur Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin und wird anschließend die Fachweiterbildung für Pädiatrische Hämatologie und Onkologie anstreben.
Ihr wissenschaftliches Interesse gilt den genetischen und molekularen Grundlagen der pädiatrischen Diffusen Mittelliniengliome. Die schlechte Prognose von ca. 1-2 Jahren dieser hochmalignen Hirntumore ist in deren Lage in Hirnstamm, Thalamus und Rückenmark, sowie in einem schnellen und aggressiven Wachstum begründet. Charakteristisch für diese Tumore ist unter anderem eine H3K27-Mutation. Im Rahmen des Projektes wird ein potentieller neuer Tumorsubtyp der Diffusen Mittelliniengliome mit H3K27, sowie BRAF-Komutation untersucht. Ziel ist es den Phänotyp, sowie das Verhalten unter zielgerichteten Therapien zu charakterisieren und Resistenzmechanismen zu identifizieren um diese langfristig therapeutisch adressieren zu können.
Während des Projektes werden Kooperationen mit dem Dana-Farber Cancer Institute in Boston, sowie dem Bambino Gesù Hospital in Rom und dem Neuropathologischen Institut der Universität Bonn stattfinden.
Lille Kurvits, PhD - Charakterisierung der synaptischen Dysfunktion in der frühen Parkinson-Krankheit durch extrazelluläre Vesikel
Lille Kurvits ist Ärztin in Weiterbildung für Neurologie mit einem Schwerpunkt auf der Erforschung neurodegenerativer Erkrankungen. Ihr aktuelles Projekt zielt darauf ab, die Rolle extrazellulärer Vesikel bei der Parkinson-Krankheit zu entschlüsseln, insbesondere deren Funktion in der Übertragung pathologisch gefalteten α-Synukleins und den daraus resultierenden synaptischen Veränderungen.
Die Arbeit fokussiert auf die Identifikation molekularer Marker in extrazellulären Vesikeln aus dem Blut von Parkinson-Patienten, um Mechanismen der frühen Synaptopathie zu verstehen und potenzielle diagnostische und therapeutische Zielstrukturen zu bestimmen. Durch den Einsatz von präklinischen Modellen, darunter Patch-Clamp-Analysen und iPSC-Technologien, soll untersucht werden, wie diese molekularer Marker synaptische Funktionen beeinflussen und welche Interventionsstrategien möglich sind.
Langfristig strebt Dr. Kurvits an, grundlegende Mechanismen der Krankheitsentstehung zu entschlüsseln und neue Wege zur Früherkennung sowie gezielte Therapien zu entwickeln, die einen nachhaltigen Beitrag zur Verbesserung der Behandlung von Parkinson-Krankheit leisten.
Dr. med. Seyed Siyawasch Justus Lattau - Evaluation of trans-barrier lipid transport in the CNS and its modulation by obesity and aging: A mouse model study with human validation cohorts
S. Siyawasch Justus Lattau beendete 2020 sein Studium der Humanmedizin an der Universität Rostock und ist seit 2021 als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Assistenzarzt in der Klinik für Neurologie in Göttingen tätig. 2022 promovierte er am Institut für Medizinische Biochemie in Rostock.
Seinen Forschungsschwerpunkt legt er auf Veränderungen des Lipidstoffwechsels bei neurologischen Erkrankungen. Lipide stellen die häufigste, jedoch am wenigsten erforschte Komponente des menschlichen Gehirns dar. In seiner bisherigen Forschung zeigte Dr. Lattau den Einfluss des zerebralen Lipidoms auf entzündliche Prozesse in einem Schlaganfallmodell und beleuchtete Veränderungen des Plasma-Lipidoms bei verschiedenen Varianten der Multiplen Sklerose. Diese Ergebnisse stehen im Einklang mit aktuellen Erkenntnissen, die darauf hindeuten, dass die Lipidzusammensetzung des zentralen Nervensystems (ZNS) hinter der Blut-Hirn-Schranke (BHS) durch den systemischen Lipidstoffwechsel beeinflusst wird. Die Mechanismen, die die Homöostase des Lipidstoffwechsels zwischen dem ZNS und dem peripheren Stoffwechsel aufrechterhalten, bleiben jedoch weitgehend unbekannt.
Im Rahmen des Forschungsvorhabens soll die modulierende Wirkung der beiden relevantesten Einflussfaktoren Alter und Adipositas auf das Lipidom in den drei Kompartimenten Blut, Hirngewebe und Liquor im Tiermodell analysiert und mit der regionenabhängigen Histologie und Transkriptomik des Hirngewebes korreliert werden. Die in dem kontrollierten Tiermodell beobachteten Muster sollen durch Plasma- und Liquor-Lipidomik von nach Alter und Gewicht stratifizierten Patienten bestätigt werden
3. Förderperiode (2026 - 2028)
In der dritten Ausschreibungsrunde wurden insgesamt 6 Clinician Scientists in das Förderprogramm aufgenommen.

Dr. med. Sophie Bachanek - Automatisierte, Deep-Learning-basierte Segmentierung und longitudinales Tracking von Tumorläsionen bei metastasiertem Nierenzellkarzinom in der CT-Bildgebung
Sophie Bachanek beendete 2022 ihr Medizinstudium an der Georg-August-Universität Göttingen und ist seit 2023 als Assistenzärztin am Institut für Klinische und Interventionelle Radiologie der Universitätsmedizin Göttingen tätig. Ihre Promotion schloss sie 2023 zum Thema der radiologischen Charakterisierung von primären Nierensarkomen ab. Seit der Promotion wirkt sie in der Arbeitsgruppe „Uro-Radiologie und klinische KI“ unter der Leitung von Prof. Dr. med. Annemarie Uhlig und Prof. Dr. med. Johannes Uhlig mit.
Der Forschungsschwerpunkt von Sophie Bachanek liegt auf der Implementierung von Modellen auf Basis der künstlichen Intelligenz (KI) zur Verbesserung der radiologischen Diagnostik bei Nierentumoren. Angesichts des zunehmenden Einsatzes von bildgebender Diagnostik steigt der Bedarf an automatisierten und reproduzierbaren Verfahren zur quantitativen Auswertung von Bilddaten. Sophie Bachanek befasst sich im Rahmen des geförderten Projektes mit der Entwicklung von Deep-Learning-basierten Algorithmen zur automatisierten Segmentierung und Nachverfolgung von Primärtumoren und Metastasen bei metastasierten Nierenzellkarzinomen in CT-Datensätzen. Ziel ist die Etablierung eines robusten KI-basierten Modells für die präzise Verlaufsbeurteilung von metastasierten Nierenzellkarzinomen.
Perspektivisch zielen ihre Forschungsbestreben darauf ab, KI-gestützte Methoden in die klinische Routine zu überführen und so zu einer Verbesserung der radiologischen Diagnostik und der onkologischen Therapieüberwachung beizutragen.

Dr. med. Niklas Bader - Schutz der kardialen Funktion durch therapeutisches Targeting des Ca2+-sensitiven Membranreparatur- und ‑fusionsproteins Dysferlin
Dr. med. Niklas Bader beendete 2023 das Studium der Humanmedizin an der Universität Göttingen und ist seit April 2024 als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Assistenzarzt in der Klinik für Kardiologie und Pneumologie tätig. Er befindet sich in der Weiterbildung zum Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie.
Sein wissenschaftliches Interesse gilt den Membranreparaturmechanismen von Kardiomyozyten. Der Herzinfarkt stellt ein Krankheitsbild mit hoher Morbidität und Mortalität dar. Ausgelöst durch Ischämie gehen Kardiomyozyten unwiderruflich zugrunde, was zur Herzinsuffizienz führt. Dies ist begründet im geringen regenerativen Potential von entdifferenzierten, postmitotischen Kardiomyozyten. Dem Schutz der kardiomyozytären Zellmembran, dem Sarkolemm, mit seinen hochdifferenzierten Mikrodomänen kommt deshalb eine entscheidende Bedeutung für die Integrität und Funktion der einzelnen Zelle und ihrer Interaktion im myokardialen Synzytium zu.
Im Rahmen des Projekts wird das Transmembranprotein Dysferlin, welches Ca2+-abhängig Reparatur- und Fusionsprozesse des Sarkolemms vermittelt, untersucht werden. Explizit wird die Rolle Dysferlins in der Plastizität und Regeneration des Sarkolemms analysiert.
Anhand funktioneller, proteomischer und mikroskopischer Analysen soll die Bedeutung Dysferlins in der Pathophysiologie der Herzinsuffizienz bewertet werden. In Kollaboration mit der Proteomics Service Unit sollen proteomische Datensätze der Herzproben durch Massenspektrometrie erhoben und durch bioinformatische Aufarbeitung neue Interaktionspartner Dysferlins identifiziert werden. Darüber hinaus wird das Verständnis der Calcium-vermittelten Vesikelfusion In Kollaboration mit der Arbeitsgruppe Moser erweitert.
Unter der Prämisse eines limitierten regenerativen Potentials wird Dysferlin als therapeutisches Target zum Erhalt der myokardialen Funktion nach Herzinfarkt eingesetzt.
Dr. med. Anna Reidenbach - Immunmodulation epidermaler und myeloider Zellen unter JAK-Inhibition – funktionelle und transkriptomische Analyse in vitro, ex vivo und in immunkompetenten 3D-Hautmodellen bei Atopischer Dermatitis und Psoriasis
Anna Reidenbach beendete 2024 ihr Medizinstudium an der Georg-August-Universität Göttingen. Seitdem arbeitet sie als Assistenzärztin in der Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie in Göttingen und befindet sich in der Weiterbildung zur Fachärztin für Dermatologie und Venerologie.
Ihr wissenschaftliches Interesse gilt den immunologischen und molekularen Grundlagen chronisch-entzündlicher Hauterkrankungen mit Fokus auf atopische Dermatitis sowie Psoriasis. Patientinnen und Patienten mit atopischer Dermatitis und Psoriasis leiden häufig unter ausgeprägtem Juckreiz, sichtbaren Hautveränderungen und teils schmerzhaften Entzündungen, die ihre Lebensqualität erheblich beeinträchtigen können. Beide Erkrankungen zeichnen sich durch unterschiedliche Störungen der kutanen Immunantwort aus. Zentral dafür sind verstärkte Zytokinsignale über Januskinasen, die zur Entzündung, einer veränderten Keratinozytendifferenzierung sowie einer eingeschränkten Barrierefunktion der Haut führen.
Im Rahmen des Projekts sollen die zelltypspezifischen Effekte der selektiven JAK-Inhibitoren Upadacitinib (JAK1) und Deucravacitinib (TYK2), die als Systemtherapeutika bei der Behandlung der atopischen Dermatitis und Psoriasis eingesetzt werden, untersucht werden. Dafür kommen sowohl In-vitro-Modelle als auch komplexe immunkompetente 3D-Hautmodelle zum Einsatz, um Veränderungen der Gewebestruktur, Immunzellinteraktion und Barrierefunktion zu analysieren. Ergänzend umfasst das Projekt eine Pilotstudie mit Einzelzell-RNA-Sequenzierung von Hautbiopsien von Patienten mit atopischer Dermatitis und Psoriasis unter Therapie mit JAK-Inhibitoren, um neue Einblicke in epidermal-myeloide Interaktionsmechanismen und potenzielle Marker zu gewinnen.

Ahmed Wagdi - Funktionelle und strukturelle Charakterisierung der Gq-Protein-vermittelten Signalwege im atrioventrikulären Knoten zur Aufklärung der Pathophysiologie atrioventrikulärer Überleitungsstörungen
Ahmed Wagdi wechselte 2017 von den USA nach Göttingen, um eine Karriere in der grundlagenwissenschaftlichen Forschung zu beginnen. 2019 schloss er den Master of Science in Cardiovascular Science an der Georg-August-Universität Göttingen ab.
Im Anschluss startete er seine Doktorarbeit am Institut für Kardiovaskuläre Physiologie und ist seit 2022 als wissenschaftlicher Mitarbeiter unter der Leitung von Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Tobias Brügmann sowie als Assistenzarzt in der Klinik für Kardiologie und Pneumologie der Universitätsmedizin Göttingen tätig. Er befindet sich in der Weiterbildung zum Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie. Seine Promotion schloss er 2024 zum Thema der optogenetischen Charakterisierung des G-Protein-gekoppelten Rezeptors hOPN5 im Herzen ab. Im Rahmen seiner Doktorarbeit entwickelte er die Software MoCA (Myocyte online Contraction Analyzer), ein optisches Fluss-basiertes Programm zur Quantifizierung kontraktiler Eigenschaften von Kardiomyozyten in Echtzeit.
Der Forschungsschwerpunkt von Ahmed Wagdi liegt auf G-Protein-gekoppelten Rezeptoren (GPCRs) und elektrophysiologischen Mechanismen im kardialen Erregungsleitungssystem, insbesondere im Sinusknoten und atrioventrikulären Knoten. Der atrioventrikuläre Block (AVB) stellt die zweithäufigste Indikation zur permanenten Schrittmacherimplantation dar, dennoch bleiben die zugrundeliegenden Pathomechanismen weitgehend unverstanden. Ahmed Wagdi befasst sich im Rahmen des geförderten Projektes mit der funktionellen Charakterisierung Gq-gekoppelter Rezeptorsignalwege (AT1R, ETAR) innerhalb der AVN-Subregionen mittels pharmakologischer Stimulation sowie optogenetischer Aktivierung unter Verwendung des hOPN5-Rezeptors. Durch simultane Kalzium- und Spannungsbildgebung werden dromotrope und chronotrope Effekte der Gq-Aktivierung analysiert. Ergänzend kommt Light-Sheet-Mikroskopie zum Einsatz, um die räumliche Verteilung verschiedener Connexine und autonomer Innervation innerhalb der AVN-Subregionen hochauflösend zu charakterisieren. Ziel ist die Identifizierung der Gq-Protein-abhängigen PKC-vermittelten Connexin-Phosphorylierung sowie die Charakterisierung des Zusammenspiels von Voltage-Clock und Ca²⁺-Clock in der AVN-Automatie.
Perspektivisch zielt seine Forschung darauf ab, durch die Erstellung eines hochauflösenden funktionellen und strukturellen Atlas des AVN neue therapeutische Ansatzpunkte für die Behandlung atrioventrikulärer Überleitungsstörungen zu identifizieren und krankheitsspezifische Pathomechanismen in verschiedenen kardiovaskulären Erkrankungsmodellen aufzuklären.

Dr. med. Nelly Leonore Wery von Limont - Frühe Reperfusionsschäden nach Herz-Kreislauf-Stillstand: Mitochondriale Mechanismen und therapeutische Modulation im Tiermodell
Dr. Nelly Wery von Limont beendete 2021 ihr Studium an der Universität Göttingen und ist seit dem als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Assistenzärztin an der Klinik für Anästhesiologie der Universitätsmedizin Göttingen tätig. Sie befindet sich in der Weiterbildung zur Fachärztin für Anästhesiologie und ist regelmäßig als Notärztin bei der Berufsfeuerwehr Göttingen tätig.
Ihr Forschungsschwerpunkt liegt auf den molekularen und metabolischen Veränderungen im Rahmen eines Herz-Kreislauf-Stillstands und der kardiopulmonalen Reanimation.
Etwa 90 % der 130.000 Patienten mit einem präklinischen Herz-Kreislauf-Stillstand starben 2024 in Deutschland. Mit Beginn der Herzdruckmassage kommt es zu einer abrupten Reperfusion der Organe, die nach vorbestehender Ischämie eine zusätzliche Gewebeschädigung am Herzen verursacht. Dieser Reperfusionsschaden kann dabei größer sein als der Schaden durch die Ischämie selbst. Die Akkumulation von Succinat während der Ischämie und anschließende Oxidation durch die Succinat-Dehydrogenase bei der Reperfusion verursachen eine übermäßige Produktion der radikalen Sauerstoffspezies (ROS). Dies führt zu frühen Veränderungen im mitochondrialen Metabolismus und Aktivierung des angeborenen Immunsystems. Bisher gibt es noch keine gezielte Therapie zur Prävention oder Minderung des Reperfusionsschadens am Herzen.
Im Rahmen des Projektes wird die genaue Charakterisierung der pathophysiologischen Signalwege der frühen Reperfusionsphase im in-vivo Rattenmodell zur kardiopulmonalen Reanimation erfolgen. Ziel ist es über die Aufklärung des zeitlichen Ablaufs und der beteiligten Prozesse neue therapeutische Ansatzpunkte zu identifizieren. Das Projekt erfolgt in Kooperation mit Prof. Thomas Krieg von der University of Cambridge.
Salome Yacob - Deciphering vulnerabilities in the p53/NIPA axis as anticancer target
Salome Yacob beendete 2023 ihr Studium an der Universität Freiburg und ist seit 2026 als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Assistenzärztin in der Klinik für Hämatologie und Medizinische Onkologie der Universitätsmedizin Göttingen tätig. Sie befindet sich in der Weiterbildung zur Fachärztin für Hämatologie und Onkologie.
Ihr wissenschaftliches Interesse gilt dem neu charakterisierten DNA-Reparatur-Protein NIPA (Nuclear Interaction Partner of ALK), und seiner Bedeutung für p53-abhängige Tumorbiologie. Der p53-Signalweg ist essenziell für die Vermittlung zwischen Zellzyklusarrest, DNA Reparatur und Apoptose nach Zellschädigung, und seine Dysfunktion ist ein Merkmal vieler aggressiver Malignome. In Vorarbeiten der Arbeitsgruppe hat sich gezeigt, dass NIPA an der Regulierung der nukleären Verfügbarkeit von p53 beteiligt ist.
Im Rahmen des Projekts soll der molekulare Mechanismus charakterisiert werden, durch den NIPA den p53-Signalweg beeinflusst. Ergänzend wird die NIPA-Expression in Tumorproben mit bekannten p53-Aberrationen bewertet und ihr Potenzial als Biomarker untersucht. Es sollen dabei molekulare Subtypen identifiziert werden, die besonders empfindlich auf eine Störung der NIPA/p53-Achse reagieren, und entsprechende Kombinationsbehandlungsstrategien im Zellmodell untersucht werden. Die Ergebnisse werden anschließend mit aus molekularen Tumorboards erhaltenen Patient*innendaten über die Tumorbiologie und das Therapieansprechen auf p53-gerichtete Therapien korreliert. Übergeordnetes Ziel des Projektes ist es, die NIPA/p53-Achse als therapeutisches Ziel zu definieren und synthetische letale Strategien für ausgewählte Patient*innen zu entwickeln.
Das Projekt erfolgt in enger Kooperation u.a. mit der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. M. Dobbelstein aus dem Department of Molecular Oncology und dem Institut für Pathologie unter der Leitung von Prof. Dr. P. Ströbel.